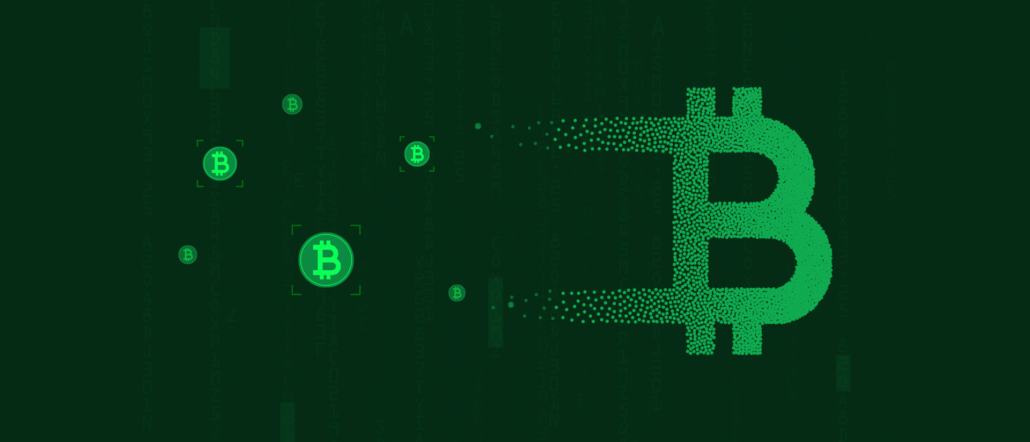Ein zweifelhafter Ruf haftet sowohl der Kryptowährung Bitcoin wie auch dem Darknet an. Medien schildern beide gerne als undurchsichtige, kriminelle Parallelwelten. Für Ransomware as a Service sind Bitcoin und Darknet willkommene Werkzeuge. Das organisierte Verbrechen hat sie sich längst zu Nutze gemacht, um seine Geschäfte zu verschleiern, auch wenn die Kriminellen damit keineswegs anonym und sicher vor Strafverfolgung sind.
Ransomware wurde 2021 zur weltweit größten Bedrohung von IT-Systemen. Wer sich erfolgreich davor schützen will, muss auch verstehen, wie die Beteiligten vorgehen. Im ersten Teil dieser Artikelserie ging es um das Geschäftsmodell von Ransomware as a Service. Teil zwei zeigte, warum diese „Professionalisierung“ auch zu einem veränderten Mindset bei den Angreifenden führt. Der dritte Teil erklärt nun, warum die IT-Werkzeuge, die die organisierte Kriminalität zur Bestellung und zur Geldübergabe nutzt, keineswegs sicher sind.
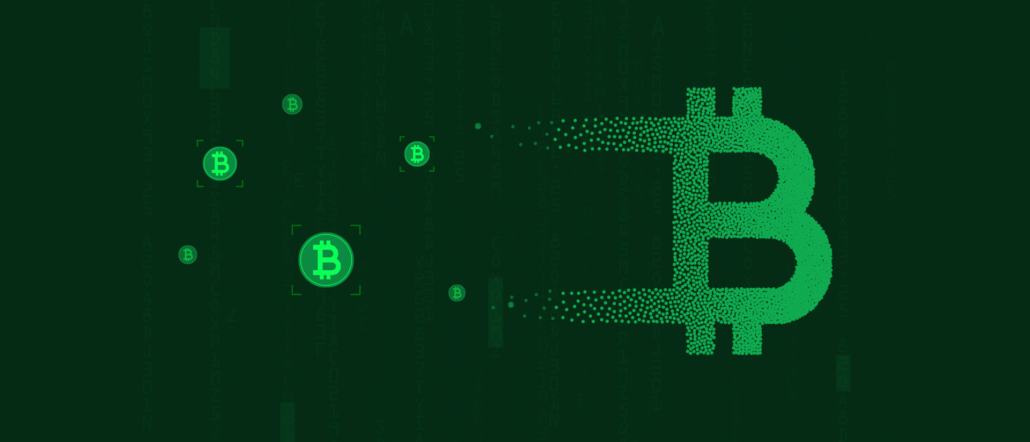
Anonym und sicher?
Bitcoin als Zahlungsmittel und das Darknet erweisen sich als praktisch, hilfreich und attraktiv für Angreifende. Unter dem Deckmantel der vermeintlichen Anonymität wähnen sie sich geschützt vor Strafverfolgung und abgeschirmt von Konsequenzen. Doch das ist ein verbreitetes Missverständnis: Weder Bitcoin noch Darknet sind in der Praxis anonym.
Während die Kryptowährung nie auf Anonymität ausgelegt war, sondern explizit auf Nachvollziehbarkeit von Transaktionen auch ohne zuverlässige zentrale Autorität, erweist sich das Darknet als nicht mal ansatzweise so anonym wie seine Macher es sich gewünscht hätten. Das zeigen auch Berichte wie die jüngsten über die „Deanonymisierungsangriffe“ von KAX17 auf das Tor-Netzwerk. Fast immer reicht der Strafverfolgung klassische Ermittlungsmethoden, um auch Ransomware-Agierende wie die REvil-Gruppe ausfindig zu machen. Die hatte laut Heise in mehr als 5.000 Infektionen eine halbe Million Euro an Lösegeldern eingetrieben.
Nie eine gute Idee: mit Kriminellen kooperieren
Egal, ob online oder offline, wer sich mit Erpressenden einlässt, ist verlassen. Als guter Rat gilt wie im richtigen Leben: niemals Lösegeld bezahlen. Ganz egal wie professionell die Hotline am anderen Ende auch scheint, Vertrauen ist nicht angebracht. Die Betreibenden von REvils Ransomware as a Service beispielsweise stahlen ihren Auftraggebenden sogar die erpressten Lösegelder über eine Backdoor in der Malware.
Dabei hatte alles so freundlich und idealistisch angefangen. Roger Dingledine und Nick Mathewson legten die Grundsteine für das Tor-Netzwerk Anfang der 2000er Jahre. Basierend auf der Idee der Zwiebelringe sollten zahlreiche kryptographisch gesicherte Schichten übereinander für zuverlässige Anonymität im Web sorgen – ihrer Meinung nach ein Grundrecht, analog zur Privacy-Definition von Eric Hughes „Cypherpunk’s Manifesto“. 2009 erblickte dann Bitcoin das Licht der Welt, erstmals beschrieben durch die fast schon mystische Figur des Satoshi Nakamoto.
Darknet und Bitcoin sind nicht „kriminell“
Weder Darknet noch Bitcoin wurden entworfen, um dunkle Machenschaften zu verschleiern oder zu ermöglichen. Ziel war das Schaffen freier, unabhängiger, vermeintlich unkontrollierbarer und weitgehend sicherer Strukturen für Informationsaustausch und Bezahlung. Wie ein Messer lassen sich die Dienste jedoch sowohl für Gutes als auch für Böses instrumentalisieren – und natürlich weiß die organisierte Kriminalität das für sich zu nutzen. Nicht immer liegt dabei der Schwerpunkt darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Meist steht die Einfachheit und Verfügbarkeit der Mittel im Vordergrund. Bitcoin und das Darknet sind schlicht die Tools der Wahl, weil sie da sind.
Aber wie in der realen Welt schnappt man die Erpressenden am einfachsten bei der Geldübergabe: Eine Blockchain wie Bitcoin dokumentiert alle jemals getätigten Transaktionen inklusive der Wallet-Informationen (also den Bitcoin-Besitzenden) und macht sie jederzeit einsehbar. Gleiches gilt für das Darknet: Selbst, wenn technisch Anonymität möglich ist, scheitern Menschen regelmäßig an den einfachsten Anforderungen. Da finden sich dann GPS-Meta-Daten in Fotos oder UPS-Codes im illegalen Shop. Der legendäre Drogenshop Silkroad flog auf, weil Mitarbeitende Fehler machten und geständig waren.
Digitalisierte, organisierte Kriminalität
Das Darknet und die Kryptowährungen sind hilfreiche Werkzeuge für die organisierte Kriminalität und damit Brandbeschleuniger für die schnell wachsende Anzahl an gravierenden Ransomware-Attacken. Aber sie sind keineswegs essenziell, noch trifft sie eine Schuld. Derartige Cyber-Kriminalität ist nur die moderne IT-Variante dessen, was wir auch auf den Straßen beliebiger Großstädte erleben können. Ransomware ist sozusagen die moderne Schutzgelderpressung, Bitcoin der Abfalleimer für die Übergabe, das Darknet die dunkle Kneipe, in der Deals vereinbart werden.
Das Perfide steckt nicht in den Werkzeugen, sondern in den Methoden und der langen Erfahrung im „Business“. Trend Micro beschreibt beispielsweise den Ansatz der „Double Extortion Ransomware“. Dabei machen sich Angreifende erst ein Bild über die Daten und drohen, diese bei Nicht-Bezahlen (also bei Nicht-Entschlüsselung) zu veröffentlichen. Organisierte Kriminalität betreibt das Geschäft mit der Erpressung nicht erst seit es Bitcoin oder das Darknet gibt. Auch wenn die beiden Technologien es Cyber-Kriminellen heute ermöglichen, zunächst unerkannt große Geldsummen zu erpressen, reichen herkömmliche Methoden fast immer zur Aufklärung. Wichtigste Voraussetzung dabei ist, dass genug Personal für die Strafverfolgung zur Verfügung steht, nicht in erster Linie dessen technische Ausstattung.
Vorsorge treffen
Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Kind im Unternehmen bereits in den Brunnen gefallen. Wer vor seinen verschlüsselten Daten steht und sich einer Lösegeldforderung gegenübersieht, dem sind das Darknet, Bitcoin und die Aufklärungsquote vermutlich erst mal zweitrangig. Viel wichtiger ist die Frage, wie man aus der misslichen Lage wieder herauskommt. Und das gelingt nur, wenn man vorbereitet war. Dazu gehören Backups, Restore-Tests und das sofortige Abtrennen aller betroffenen Maschinen (Network Split) – also proaktives Risikomanagement, Desaster Recovery Tests und stetige Pflege der eigenen Systeme. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Multi-Faktor-Authentifizierung, die verhindert, dass sich Angreifende allein durch erworbene Passwörter von einem System zum nächsten hangeln.
Am wichtigsten ist es jedoch, gar nicht erst in kritische Situationen zu gelangen und Schwachstellen in den eigenen Systemen zu erkennen und schnell zu schließen. Modernes Schwachstellenmanagement wie das von Greenbone leistet genau das: Es legt Angreifenden Steine in den Weg und macht das Firmennetzwerk unattraktiv, aufwändig und somit abschreckend für die professionellen Cyber-Kriminellen, nicht nur aus der Ransomware-as-a-Service-Welt.
Die Produkte von Greenbone überwachen das Unternehmensnetzwerk oder externe IT-Ressourcen auf potenzielle Schwachstellen, indem sie es fortlaufend und vollautomatisch untersuchen und garantieren als Greenbone Enterprise Appliances oder dem Greenbone Cloud Service (in deutschen Rechenzentren gehostete Software as a Service) Sicherheit durch stets aktuelle Scans und Tests.
Wie das funktioniert, beschreibt Elmar Geese, CIO/CMO bei Greenbone, ebenfalls hier im Blog anhand eines Posts rund um die log4j-Schwachstelle. Außerdem erklärt Geese, wie schnell und sicher die Administration und das Management auch bei den neuesten Schwachstellen informiert wird und wie genau der Scan nach Schwachstellen wie Log4Shell abläuft.